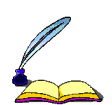
vom Schuster zum katholischen Sozialreformer
Adolph Kolping wurde am 08.12.1813 in Kerpen bei Köln. Mit 13 Jahren begann er seine Lehre beim örtlichen Schuhmachermeister Meuser. Getrieben von dem Wunsch nach handwerklicher Perfektion, ging er nach Beendigung seiner Lehre auf Wanderschaft. Sein Weg führte ihn nach Sindorf, Düren, Lechenich und Köln. In seiner knappen Freizeit lernte Kolping bis tief in die Nacht hinein Latein und Griechisch, so dass er mit 24 Jahren das angesehene Kölner Marzellengymnasium besuchen konnte.
1841 bestand er
das Abitur. Musste er sein Schulgeld und seinen Unterhalt weitgehend selber
finanzieren, so hatte er nun mehr Glück: Er erhielt ein Stipendium für ein
Theologiestudium.
So begann der Spätberufene mit 28 Jahren sein Studium in München. 1842
wechselte er zu der für seine Heimatdiözese Köln zuständigen Universität
Bonn und beendete 1844 sein Studium erfolgreich. Nach dem anschließenden
Besuch des Kölner Priesterseminars empfing er am 13.4.1845 in der Kölner
Minoritenkirche die Priesterweihe.
Kolping erlebte den Zusammenbruch der Zünfte. Mit
Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen 1810 änderte sich das Verhältnis
zwischen Meister und Gesellen. Die Meister empfanden sich nicht mehr als
Schutzherren, sondern betrachteten die Gesellen zunehmend als bloße
Arbeitskräfte.
Damit verloren die Gesellen auch ihr Zuhause in der Familie des Meisters.
Diente früher die Wanderschaft der fachlichen Qualifikation der Gesellen, so
mussten sie nun jahrelang von einem Ort zum anderen umherzuziehen, um in der
Ferne eine Anstellung zu finden.
Hierbei lernte Adolph Kolping das Elend der wandernden Gesellen am eigenen
Leibe kennen: Kein Heim, keine Familie, keine Perspektive.
Nach der Priesterweihe trat mit knapp 32 Jahren seine erste Stelle als Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld an. Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal, war ein Sinnbild der industriellen Revolution. Fabriken und verarmte Arbeiter prägten das Stadtbild.
In dem regen Gemeindeleben der St. Laurentius Kirche lernte Kolping den Lehrer Johann Gregor Breuer kennen. Diesem war es gelungen, meist junge Handwerker aus der Gemeinde in einem Chor, später in dem am 6.11.1846 gegründeten „Katholischen Jünglingsverein zu Elberfeld“ zusammenzubringen. Ziel dieser Vereinigung war es, jungen Handwerkern Bildung, Geselligkeit und religiösen Halt angedeihen zu lassen.
Er engagiert sich stark den Gesellenverein und ruhte nicht, ihn bekannt zu machen und warb dafür, in anderen Orten Gesellenvereine zu gründen und den jungen Handwerkern eine Zufluchtsstätte zu gewähren.
Adolph Kolping ließ sich im April 1849 als Domvikar nach
Köln versetzen. Kurze Zeit später, am 6. Mai 1849 gründete er zusammen mit
mindestens 19 Gesellen in der Kolumbaschule den Kölner Gesellenverein.
Vorbild war das Elberfelder Modell. Der Verein erfuhr regen Zulauf; im
Januar 1850 zählte er bereits 550 Mitglieder.
Der rasche Zuwachs konnte trotz der an Boden gewinnenden Ideen von Marx und
Engels nicht gestoppt werden. Denn Kolping traf die spezifischen Bedürfnisse
der Gesellen nach fachlicher, politischer wie auch religiöser Weiterbildung
einhergehend mit Geselligkeit und familiären Zusammenhalt. Die Einführung
von Selbsthilfeeinrichtungen wie Kranken-, Spar- und Unterstützungskassen
taten das ihre dazu.
Mit steigender Mitgliedsanzahl drängten sich zunehmend Platzprobleme auf.
Deshalb warb 1852 der Vereinspräses Kolping in seiner Programmschrift „Für
ein Gesellenhospitium“ für das Errichten von Gesellenhäusern in allen
Vereinen. Diese sollten nicht nur als Freizeit- und Bildungsstätte dienen,
sondern auch als familiäre Herberge für wandernden Gesellen. Am 14.8.1852
konnte er seinen Plan realisieren; er kaufte ein eigenes Haus für den Kölner
Gesellenverein in der Breite Straße. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden
Einweihung des Kölner Gesellenheims im Jahre 1853 bezeichnete er sich selbst
scherzhaft als Herbergs- und Gesellenvater.
Die wandernden Gesellen trugen die Vereinsidee von Kolping in die Welt
hinaus.
So fand das Kölner Vorbild schnell Nachahmer anderenorts. Kolping war von
Anfang an darauf bedacht, dem Gesellenverein ein organisatorisches
Rahmenwerk zu verschaffen. Deshalb gab es Statuten, die von Zeit zu Zeit an
die jeweiligen Verhältnisse angepasst wurden. Kolping legte überdies großen
Wert auf eine geordnete überregionale Ausbreitung seines Vereins. Auf
Anregung Kolpings schlossen sich die drei ältesten Vereine – Elberfeld, Köln
und Düsseldorf – am 20. Oktober 1850 zusammen zum „Rheinischen
Gesellenbund“. Dieser wurde 1851 umbenannt in „Katholischer Gesellenverein“,
um den Anschluss von Gesellenvereinen außerhalb des Rheinlandes zu
ermöglichen.
Heute gibt es rund 2.800 Kolpingsfamilien in ganz
Deutschland, die im Sinne Adolph Kolpings wirken.
Gründung der Kolpingsfamilie in Dinslaken (1890)
Gab es den "Arbeiter" erst mit er in Deutschland heraufkommenden "industriellen Revolution", so haben die Handwerker das Fundament einer Jahrtausende alten Tradition. Doch die Probleme, die die Industrie heraufbeschwor, berührte auch die Verhältnisse im Handwerk.
Den Anfang machte ein „Gesellenverein" im Jahre 1854. Kolpings Idee setzte am 14. September 1890 in Dinslaken seine Wurzeln. Zur Zeit des Pfarrers Melcop gründete Kaplan Ross einen Gesellenverein, der den Namen St. Joseph-Verein (Gesellen und Arbeiterverein) annahm. Da es noch keine Arbeiterorganisation gab, war der Einschluss dieses Berufsstandes nur natürlich. Erster Vizepräses war Johann Blies. Auch in Dinslaken wurde ganz im Sinne von Adolph Kolping, der die Handwerksgesellen aus einem "Bildungsdefizit" herausführen wollte, gearbeitet. Dazu gehörte die Einrichtung einer "Sonntagsschule" mit einem breiten Bildungsangebot. Außer Veranstaltungen zur religiösen Erziehung der Mitglieder wurden berufliche Fortbildungskurse angeboten, dazu kamen Themen aus Politik, Kunst und Technik. Auch gute Unterhaltung kam nicht zu kurz.
1904 verließen die Arbeiter den St. Joseph-Verein. Auf Anregung von Pfarrer Melcop schlossen sie sich mit anderen Arbeitern zu einem eigenständigen Arbeiterverein zusammen. Dies war die Geburtsstunde der KAB, der Katholischen Arbeiter Bewegung.
Seit dem Gründungstag, am 14. September 1890, hat die Kolpingfamilie St. Vincentius, Dinslaken, eine wechselvolle Zeit erlebt.
Ruhige Zeiten in Frieden und Eintracht, aber auch in Kriegen und Unterdrückung; doch sie hat nie den Mut verloren und die Idee ihres Gründers, Adolph Kolping, weiter getragen und an nachfolgende Generationen weitergegeben.
Den größten und traurigsten Einschnitt erlebte die Kolpingfamilie während der nationalsozialistischen Zeit von 1934 - 1945. Die Verbote der Nazi-Regierung trafen alle katholischen Bünde und Vereine. Die letzte offizielle Zusammenkunft der Kolpingfamilie in Dinslaken fand am 10. März 1935 statt. Danach trafen sich die Kolpingsöhne nur noch im privaten Bereich.
Trotz des Versammlungsverbots und der Willkür der damaligen Machthaber lebte der Geist Adolph Kolpings weiter und so ließen sich 1937 noch junge Männer in die Gemeinschaft aufnehmen.
Nach dem Zusammenbruch des „1000 jährigen Reiches" 1945, fanden sich 10 ältere Kolpingsöhne zusammen und ließen das Vereinsleben wieder aufleben. Wie ein „Phönix aus der Asche" erstand die Kolpingfamilie wieder.
Schon Ende 1946 zählte die Kolpingfamilie 140 Mitglieder und 45 Jungmitglieder und in den folgenden Jahren wuchs die Zahl auf 204 an.
Das Kolpingwerk hat sich seit seiner Gründung weiter entwickelt. Nicht mehr nur männliche Junggesellen durften Mitglieder werden, sondern seit 1966 auch Frauen.
Von Adolph Kolping stammt der Ausspruch: „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist".
Es gibt auch heute noch viele Kolpingmitglieder, die durch ihr soziales Engagement - in Kirche, Politik, Verwaltung und auf anderen Gebieten - den Geist Adolph Kolpings weiter tragen und seine Ideen umsetzen.
Die Kolpingsfamilie in Dinslaken ist auch heute noch eine lebendige Gemeinschaft mit Veranstaltungen der verschiedensten Art, wobei der christliche Aspekt immer im Vordergrund steht.
Mit Ratsbeschluss vom 19.06.1957 wurde die Verbindungsstraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Duisburger Straße als Kolpingstraße benannt.