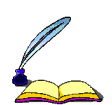|
Dinslaken in der Reformationszeit
Während die Altgläubigen eine
dinglich-gegenständlich geprägte Heiligkeit hochschätzten, wie sie ihnen in
den als heilig angesehenen Elementen der Liturgie begegnete (Brot und Wein,
Weihwasser, Öl etc.), lehnten die Lutheraner derartiges ab. Sie
favorisierten stattdessen eine stark personale Heiligkeit, die sich der
getaufte Christ von Gott zusprechen lässt Maßgeblich war das Hören des
Gotteswortes und seine Befolgung.
Das neugläubige Verständnis
von Heiligkeit sah das Heil eines Gemeinwesens davon abhängig, dass das Wort
Gottes verkündigt wird, dass die Menschen es gläubig annehmen und im
Gehorsam befolgen; eine ausgleichende „Ersatzinstanz“ für eigene Schwächen
im Bereich des Religions- und Soziallebens (Heilige als Fürsprecher) entfiel
ebenso wie eine von ausgleichend-heiligen Mittlerinstanzen abhängige
Charakterisierung heiliger Orte.
Mit Blick auf ein Heiligkeit
spendendes “Verbindungsglied“ zwischen Himmel und Erde unterschieden sich
die Sakralisierungskonzepte von Katholiken und Lutheranern deutlich
voneinander. Fraglos sahen die Altgläubigen die Heiligkeit der
Stadtgemeinschaft darin begründet, dass sie immer wieder in die himmlische
Liturgie einstimmten. Während die Lutheraner das Medium der Verbindung
zwischen Himmel und Erde vor allem im göttlichen Wort sahen, welches - ihrer
Überzeugung nach - im Himmel und auf Erden gleichermaßen erklingt und
angenommen werden will. Die Nähe zum Himmel begründete sich in dem ihnen
himmlisch geschenkten und gläubig-tätig zu befolgenden Wort Gottes in der
Heiligen Schrift.
|
Die Klever Herzöge schwankten lange zwischen der alten
und neuen Lehre hin und her. Johann III. blieb zunächst katholisch. Bei
Herzog Wilhelm trat die Scheu vor einer festen Stellungnahme in dem
religiösen Streit und das Bestreben zu vermitteln noch mehr zu Tage. Er
näherte sich dabei der evangelischen Partei. In den letzten Jahren feiner
Regierung neigte er wieder dem katholischen Bekenntnis zu. Unter Johann
Wilhelm bekam die evangelische Bewegung freien Spielraum. Aber es dauerte
lange, ehe es zu einer Scheidung der Gemeinden kam. Viele Jahre wurde in
manchen Kirchen die neue neben der alten Lehre vorgetragen, aus demselben
Becken katholisch und reformiert getauft. Das stellenweise friedliche
Zusammenleben der religiösen Parteien änderte sich erst unter dem Einfluss
des spanisch-niederländischen Krieges. Viel Verwirrung brachten auch die
Wiedertäufer und Bilderstürmer.
Auch in Dinslaken trat ein Wiedertäufer auf, Johann
Willmsen, ein Holländer, der viel Unruhe stiftete. Willmsen wurde 1574 in
Dinslaken verhaftet, nach Kleve abgeliefert und dort vor ein Gericht
gestellt und gefoltert.
"Es hat aber dieser elender Mensch seinen verordneten
Richtern, ehe er alles bekennen wollen, viel zu schaffen gemacht, also auch,
daß seinetwegen der Eisernen Halsband, welcher allnoch zu Kleve vorhanden,
verfertigt worden, durch welches mittel (weilen es Ihm wegen Größe der pein
Den schlaff benohmen) eine unzählige Zahl aller feiner Laster und
missethaten bekannt, auch mit seiner eigenen Hand im protocollo, so noch
fürhanden, unterschrieben".
Bereits 1548/49 wird unter den Gebieten, in denen die
Reformation Eingang gefunden hat, auch das Amt Dinslaken genannt. Der
Protestantismus spaltete sich in mehrere Richtungen, zwei davon fassten auch
in Dinslaken Fuß: die Reformierten und die Lutheraner.

|
|
Die reformierte Gemeinde
Die erste Kunde von dem Dasein
einer reformierten Gemeinde erhalten wir aus dem Protokoll der klevischen
Synode vom Jahre 1603, in dem man auf Anregung der Weseler Abgeordneten
bestimmte, das unter anderen auch die Kirche zu Dinslaken zur »klassischen
Versammlung« berufen werden sollte. Da noch eine geeignete Kirche fehlte,
versuchte am 29. Dezember 1610 Henrikus Kopius, reformierter Prediger in
Wesel, sich gewaltsam in den Besitz der Dinslakener katholischen Kirche zu
setzen. Der Rat der Stadt trat zusammen. Kopius erhielt eine abschlägige
scharfe Antwort und musste mit dem Rentmeister Johann van Diepenbruch die
Stadt am nächsten Tage verlassen.
Schließlich erhielten die Reformierten auf dem
Dinslakener Kastell einen Saal zugewiesen, wo sie bis 1614 ihre
Gottesdienste abhalten konnten. In diesem Jahre nahmen die Spanier unter
Marquis Spinola die Stadt ein, und die Räumlichkeiten des Kastells wurden
restlos mit spanischem Kriegsvolk belegt. Während der spanischen
Besatzungszeit wurde bei einem gewissen Adam Reiners in der Stube und Im Hof
gepredigt.
|
1626 konnten die Reformierten nach dem Abzuge der
Spanier wieder ihren Saal auf dem Kastell in Anspruch nehmen. 1653 bauten
sie sich schließlich dort, wo heute die evangelische Stadtkirche steht eine
eigene Kirche. Die Mittel zum Neubau verschaffte sich der Prediger Johann
Jakob Desloch auf Kollektenreisen in England und Holland. Am 30. April 1717
brannte diese Kirche ab, wobei nur die Mauern stehen blieben. Erst sechs
Jahre später, am 7. März 1723, konnte die Kirche wieder eingeweiht werben.
In den Jahrzehnten nach dem Abzug der Spanier hatten
sich die Gemüter merklich beruhigt. Und wie in einer alten Chronik zu lesen
"ist ihnen (den Reformierten) aber von den katholischen Einwohnern der Stadt
in ihrem Predigtamt niemals einige Turbation geschehen, sondern haben in
fried und einigkeit mit einander gelebt."
 |
|
Die Lutheraner
Die lutherische Gemeinde wurde erst am 23. Januar 1611
in Dinslaken öffentlich begründet. An diesem Tage hielt der erste
lutherische Pfarrer Johann Scheffer aus dem Waldeckschen seine
Antrittspredigt In der vom Magistrat der neuen Gemeinde überlassenen
Hospital- oder Gasthauskirche. Das Gebäude wurde im Jahre 1817
wegen Baufälligkeit zum Abbruch verkauft. Sie hat
neben dem alten Bürgermeisteramt gestanden.
Schon im Gründungsjahr 1611 wurde die erste
Generalsynode der lutherischen Gemeinden des Herzogtums Kleve in Dinslaken
abgehalten. Herzog Wolfgang Wilhelm hatte sie selbst in Düsseldorf
ausgeschrieben.
|
Am 2. November, dem Reformationstage, 1817 wurde
schließlich die Vereinigung der reformierten und lutherischen Gemeinden
beschlossen und auch durchgeführt.
 |
|
Die Errichtung der Kirche
Nachdem die reformierten Gemeinden am Niederrhein 1648 das Recht zur freien
Religionsausübung erhalten hatten, begannen sie Kirchen zu bauen. Auf den
Turm der Gotteshäuser setzten sie statt des Hahnes und manchmal auch des
Kreuzes als Zeichen durchkämpfter Glaubensnot und bewahrter Gemeinschaft
gerne den Engel mit der Posaune, auch mit Bezug auf den niederländischen
Glaubenskampf „Geusendaniel“ genannt. Ein solcher befindet sich auch bis
heute auf der Stadtkirche; wenn auch nur als kleine Wetterfahne am Ende des
Dachfirstes. Dieses Symbol ist verbunden mit dem Bibeltext, Offenbarung 14,6
f.: „Und ich sah einen Engel, der ein ewiges Evangelium an die Bewohner
dieser Erde zu verkünden hatte, und er sprach mit lauter Stimme: Fürchte
Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.“
Zu dieser Botschaft bekannte sich auch die Dinslakener reformierte Gemeinde,
als sie 1722 über dem Portal der zum zweitenmal errichteten Kirche das
einladende, mahnende Wort setzte: „Gehe durch mich in Gottes Haus in der
Furcht des Herrn ein und aus.“
Im Jahre 1717 fiel die im Jahre 1653 von der
reformierten Gemeinde errichtete erste Kirche einem Brand zum Opfer. Mit ihr
verbrannten 10 umliegenden Häusern und Scheunen. Auch das Pfarrhaus war
seinerzeit ein Raub der Flammen geworden.
Die heutige Kirche hat eine dramatische Baugeschichte.
Bartolomeo Sala trug nicht die Schuld daran, dass der Turm der Kirche
einstürzte, bevor er überhaupt fertig war. Sala war der Architekt, der 1720
die Pläne für einen Neubau lieferte. Sala war ein wandernder Architekt,
einer der begabten Italiener, die sich auf einen harmonischen, schlichten
Barockstil verstanden. Den Herren Presbytern waren die Pläne des Herrn Sala
aber zu aufwendig. Im Protokoll steht: "den Herren zu hoch geloffen".
Zimmermeister, Bauleiter und Bauunternehmer wollten es billiger machen, und
prompt stürzte der Turm zusammen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Sala
musste wieder herkommen und neue Pläne machen. Aber die Sünden der Pfuscher
stecken immer noch im alten Gemäuer. Schon 1859 wurden Stimmen laut, die den
Abbruch der Kirche forderten. In den folgenden Jahren waren mehrfach
Generalüberholungen fällig.
|
Im Jahre 1904 wurde „in Durchbrechung des reformierten
Prinzips“ die Sakristei angebaut.
In früheren Zeiten war es üblich, dass die
verstorbenen Gemeindemitglieder auf dem Kirchhof beerdigt wurden. Mit
Anlegung des ersten Kommunalfriedhofs am Neutor wurde im Jahre 1818 im Zuge
des allgemeinen staatlichen Verbotes, innerhalb der Stadt zu beerdigen, auch
die Neubelegung des Gemeindefriedhofs im Schatten der Kirche eingestellt.
1973 wurde der Friedhof im Zuge des Ausbaus von Brück- und Duisburger Straße
eingeebnet.
Die in den Jahren 2000/01 durchgeführten umfangreichen
Renovierungsarbeiten lassen hoffen, dass uns die Kirche noch für lange Zeit
erhalten bleibt.

|